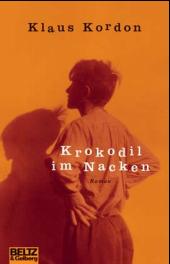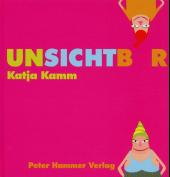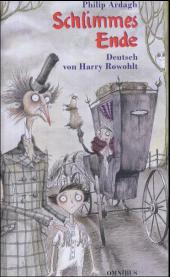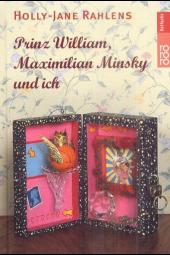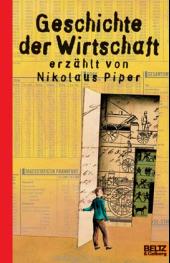|
Jugendliteraturpreis 2003
|
|
Der
Deutsche Jugendliteraturpreis wird seit 1956 vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
gestiftet und jährlich verliehen. Ausgezeichnet werden
herausragende Werke der Kinder- und Jugendliteratur.
Erstmals in der Geschichte des Deutschen Jugendliteraturpreises
verleiht dieses Jahr eine unabhängige Jugendjury den "Preis der
Jugendlichen". Die Jury besteht aus sechs über die
Bundesrepublik verteilten Jugendjurys. Parallel dazu besteht die
Kritikerjury nun ausschließlich aus Erwachsenen. Sie vergibt den
Deutschen Jugendliteraturpreis weiterhin in den Sparten
Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch. Die Jurys
prüfen die Bücher aus der Produktion des Vorjahres und
nominieren davon sechs Titel pro Sparte. Mit der Auswahl der
Jugendlichen werden insgesamt 30 Titel für den Deutschen
Jugendliteraturpreis nominiert. |
|
|
|
|
Preis der
Jugendjury an Klaus Kordon |
|
|
|
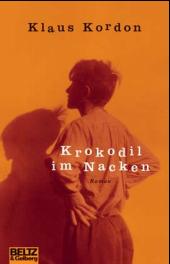
Krokodil im Nacken
Roman, Beltz & Gelberg 2003.
ab 13
mehr Info
bestellen
|
Die deutsche Geschichte des
20. Jahrhunderts ist der brisante Stoff, aus dem Klaus Kordons
Meisterwerke sind: In seinem neuen Roman erzählt er die bewegende
Lebensgeschichte des Manfred Lenz, der nach einem missglückten
Fluchtversuch aus der DDR ein Jahr in
Stasi-Gefängnissen verbringt. Lenz – das Alter Ego des Autors – erinnert
sich an seine Kindheit, seine Jugend und die Verzweiflung, die ihn mit
seiner Familie zur Flucht in den Westen zwingt. Ein Zeitpanorama, wie es
spannender nicht sein könnte.
Stasi-Untersuchungsgefängnis Berlin-Hohenschönhausen. In der Zelle 102
sitzt Manfred Lenz, in einer anderen seine Frau Hannah. Ihre Kinder
Silke und Michael sind im Kinderheim untergebracht. Eine missglückte
Republikflucht, im Sommer 1972, hat die Familie auseinander gerissen. Viele Monate Einzelhaft, Schikanen, endlose
Verhöre durch die Stasi. In dieser Zeit rekapituliert Lenz sein Leben:
Da ist die Kneipe der Mutter am Prenzlauer Berg, in der er nach dem
Krieg aufwächst. Beim Einmarsch sowjetischer Panzer auf dem Potsdamer
Platz, am 17. Juni 1953, ist der zehnjährige Manne dabei. Da ist, nach
dem Tod der Mutter, das Kinderheim, in dem sechshundert Kinder und
Jugendliche mit militärischem Drill zu jungen Sozialisten erzogen werden
sollen und aus dem Manne Lenz bald rausfliegt. Da ist die Insel in der
Spree – dreißig Jungen im Jugendwohnheim – und nur wenige hundert Meter
entfernt die verlockende Grenze nach West-Berlin. Nach dem 13. August
1961 flüchten seine besten Freunde- der 18-jährige Manfred Lenz geht
nicht mit. Die Liebe zu Hannah, ihre frühe
Hochzeit, die schwierige Zeit als Wehrpflichtiger und der berufliche
Aufstieg als Exportkaufmann, der Reisen bis ins ferne Asien mit sich
bringt, bestimmen fortan Lenz' Leben. Er könnte zufrieden sein,
vielleicht sogar glücklich, nach dem Prager Frühling 1968 aber sitzt ihm
das "Krokodil" im Nacken ... Am Ende des Romans werden die Häftlinge
Manfred und Hannah Lenz von der Bundesrepublik freigekauft. Erst ein
Jahrspäter dürfen ihre Kinder folgen.
|
|
|
Jurybegründung:
Klaus Kordon beschreibt die Stasi-Haft und die Vergangenheit
von Manfred Lenz so, dass wir Leser miterleben, wie Manne zum
Manfred wird. Seine Kindheit im Heim und auf der "Insel der Jugend"
ist so realistisch dargestellt, dass wir uns heute vorstellen
können, wie eine Jugend vor einigen Jahrzehnten jenseits des
"Eisernen Vorhangs" ausgesehen hat. Es ist zwar eine Zeit, über die
wir Schüler im Geschichtsunterricht hören, zu wenig aber erfahren
wir über einzelne Menschen, über das Alltägliche, fernab von
Staatsverträgen und Wettrüsten. Genau das hat uns an diesem Buch so
sehr gefallen, es geht um Einzelschicksale, um Stasi-Offiziere
ebenso wie um Manfred und Hannah. Besonders gelungen finden wir die
Beschreibung der Inhaftierung. Es ist unbegreiflich schwer, sich
vorzustellen, was ein Mensch in Einzelhaft tut, wie er sich in fast
völliger Isolation am Leben hält, wie nahe Resignation und
Festklammern an der Hoffnung beieinander liegen. Zusammengefasst:
Auf jeden Fall ein lesenswertes Buch! |
|
|
|
|
|
Preis für
das beste Buch in der Sparte Bilderbuch an Katja Kamm |
|
|
|
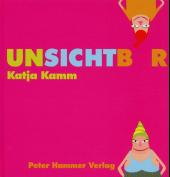
Unsichtbar
Hammer
2002
ab 3
mehr Info
bestellen |
Reisende schweben in
geheimnisvollem Gelb, ein spielendes Mädchen stolpert über scheinbar
nichts und einem Pechvogel kommt das Hemd urplötzlich abhanden: hier
stimmt doch was nicht! Zum Glück klärt sich alles auf der nächsten
Seite auf, doch hier wartet gleich die nächste rätselhafte
Ungereimtheit ... Nicht selten hängt unsere Sicht der Dinge vom
Hintergrund ab, vor dem wir wahrnehmen. Katja Kamm spielt in ihrem
originellen Bilderbuch-Debut mit unseren Sehgewohnheiten und zeigt
in witzigen Bildfolgen ganz ohne Worte, dass scheinbar Unsichtbares
überall darauf wartet, von uns entdeckt zu werden. |
|
|
Jurybegründung
Ein Bilderbuch, das ohne Worte auskommt, das Seh- und
Wahrnehmungsschule ist und gleichzeitig eine witzige Geschichte auch
für kleinere Kinder erzählt. In Katja Kamms Erstlingswerk ist schon
das Cover Programm: Der vorletzte Buchstabe des Titels bleibt
unsichtbar, wird aber dennoch vom Betrachter beim Lesen ergänzt. Und
auch die ungewöhnliche, knallige, am Computer komponierte Farbgebung
bricht mit Hilfe der gewagten Kombination von Giftgrün, Hellblau und
Orange auf magentafarbenem Grund unsere herkömmlichen
Farbsehgewohnheiten auf. Vor Hintergründen in wechselnden Farben
erzählt Katja Kamm eine fortlaufende Bildgeschichte, in der allerlei
überraschende Missgeschicke den Betrachter belustigen: Ein Junge
verliert erst sein Eis und später seine Hose, ein Mädchen stolpert
über einen unsichtbaren Hund, dieser pinkelt anschließend auf ihren
Ball, ein Fahrradfahrer fährt vor einen nicht sichtbaren Baum.
Gleichzeitig bleibt jede Doppelseite für sich lesbar und stellt eine
in sich abgeschlossene Episode dar. Durch den Wechsel der
Hintergrundfarbe werden diese Elemente sichtbar oder verschwinden,
werden in unserer Vorstellung ergänzt und stellen unsere Wahrnehmung
auf die Probe. Katja Kamm gelingt auf diese Weise ein amüsantes
Spiel mit ästhetischen Erwartungen, aber auch mit bildnerischen
Klischees. |
|
|
|
Preis für
das beste Buch in der Sparte Kinderbuch an
Philip Ardagh (Text) und
David Roberts (Illustr.) |
|
|
|
|
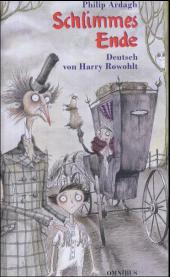
Schlimmes Ende
Omnibus bei Bertelsmann
2003
ab 10
mehr Info
bestellen |
Eddies Eltern leiden an einer seltsamen Krankheit. Ganz
gelb sind sie, dazu wellig an den Rändern, außerdem stinken sie nach
alten Wärmflaschen. Dr Keks' Behandlung sieht Bettdecken aus braunen
Papiertüten vor sowie das Lutschen von Zwiebeln undEiswürfeln in
Form berühmter Generäle. Damit Eddie sich nicht ansteckt, wird er zu
Verwandten geschickt. Pech für Eddie, dass es sich dabei um seinen
Wahnsinnigen Onkel Jack und seine Wahnsinnige Tante Maud handelt.
Und dass ihr Haus "Schlimmes Ende" heißt ... |
|
|
Jurybegründung
Eddies Eltern sind ganz gelb im Gesicht und "an den Rändern etwas
wellig". Damit Eddie nicht auch von dieser abscheulichen Krankheit
angesteckt wird, holen ihn der Wahnsinnige Onkel Jack und die
Wahnsinnige Tante Maud ab. In Episoden wird von der Kutschreise
erzählt, die Eddie zu deren Anwesen "Schlimmes Ende" bringen soll.
In der komplett verrückten Familie tritt Eddie als Einziger
verlässlich unauffällig-vernünftig auf. Desto skurriler erscheint
das übrige Personal des Romans: Hausbesorger, Theaterdirektor,
Waisenhaus-Direktorin – alle sind auf die krudeste Weise
durchgeknallt. Davon zeugen auch die Federzeichnungen David Roberts
mit ihren spitznasigen, verdreht anmutenden Figuren.
Philip Ardagh peitscht den Leser von einem kuriosen Einfall zum
anderen. Dabei entwickelt er seine Geschichte bei aller Logik völlig
grotesk. Dazu greift er selbst als allwissender Erzähler in die
Geschichte ein und gefällt sich in pseudo-wissenschaftlichen
Abhandlungen wahrhaft Sternescher Manier. Der Übersetzer Harry
Rowohlt findet für den trockenen Sprachwitz des Engländers einen
originellen, skurrilen Ton und trägt so zum Vergnügen des deutschen
Lesers bei. Kein einfacher, aber ein wahrhaft "schräger" Roman!
|
|
|
|
Der Preis für
das bestes Buch in der Sparte Jugendbuch an Holly-Jane Rahlens |
|
|
|
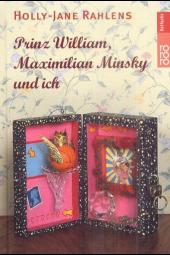
Prinz William, Maximilian Minsky und ich
Rowohlt TB 2002
ab 12
mehr Info
bestellen
|
Nelly Sue Edelmeister ist zukünftige Weltraumforscherin,
brillante Schülerin und – verliebt. Und zwar seit der Beerdigung von
Prinzessin Diana: Kein Bildschirm weltweit, auf dem man nicht den
trauernden Prinzen William sehen konnte! Lucy, Nellys amerikanische Mutter, findet das gar nicht
komisch. Statt königlicher Websites soll ihre Tochter lieber die
Thora studieren: Nellys Bat-Mizwa, die festliche Aufnahme der jungen
Erwachsenen in die jüdische Gemeinde, steht bevor. Doch als die
Schulmannschaft zu einem Basketballturnier nach Eton eingeladen
wird, hat Nelly, die vorher um jeden Sportplatz einen weiten Bogen
gemacht hat, nur noch ein Ziel: Sie will mit. Vielleicht lässt sich
ja ein Deal mit diesem Basketball-Crack im Fledermaus-Look, diesem unsäglichen Maximilian Minsky, arrangieren
... |
|
|
Jurybegründung
Nelly Sue Edelmeister, 13 Jahre alt, ein ebenso kratzbürstiges wie
unsportliches Berliner Mädchen, Tochter einer amerikanisch-jüdischen
Mutter und eines nichtjüdischen deutschen Vaters, steht kurz vor
ihrer Bat Mizwa und hat sich gerade unsterblich in den englischen
Prinzen William verliebt. Als die Basketballmannschaft ihrer Schule
eine Einladung nach England erhält, nimmt Nelly kurz entschlossen
Unterricht bei dem gleichaltrigen Maximilian Minsky, obwohl sie ihn
eigentlich nicht ausstehen kann. Zu den privaten Turbulenzen
gesellen sich die familiären Wirren: Nellys Vater beginnt ein
Verhältnis mit Maximilians Mutter, und als sich Nelly kurz darauf
noch mit ihrem Hebräischlehrer überwirft, scheinen ihre Bat Mizwa
und Prinz William in weite Ferne gerückt.
Temporeich und mit sehr viel Sprachwitz werden hier die
tragikomischen Befindlichkeiten eines heranwachsenden Mädchens in
Szene gesetzt. Ohne die Erinnerung an die jüdisch-deutsche
Vergangenheit vollkommen auszusparen, wird hier erstmals ein
realistisch anmutendes Bild jüdischen Alltags in der deutschen
Gegenwart entworfen. |
|
|
|
Der Preis für
das bestes Buch in der Sparte Sachbuch an Nikolaus Piper |
|
|
|
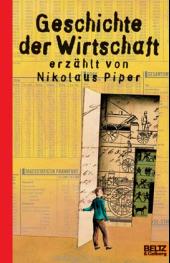
Geschichte der
Wirtschaft
Beltz 2002
ab 12
mehr Info
bestellen
|
Vom ersten Tauschhandel in der Jungsteinzeit bis zur
umstrittenen Globalisierung unserer Tage – Nikolaus Piper erzählt
die Geschichte der Wirtschaft und des ökonomischen Denkens.
Sachkundig, anschaulich, unterhaltsam vermittelt der Autor von
"Felix und das liebe Geld" volks- und betriebswirtschaftliches
Grundwissen.
Weltweiten
Handel, Geld und Aktien, Banken und Börsen – all das gab es nicht
schon immer. Unsere Vorfahren haben ganz klein angefangen: Sie
tauschten Bärenfelle und Tonkrüge, Muscheln
und Münzen. Doch als sie vor 10.000 Jahren Landwirtschaft,
Arbeitsteilung und Tauschhandel erfanden, legten sie den Grundstein
für unsere moderne Welt der Wirtschaft.
Nikolaus Piper nimmt den Leser mit auf eine Zeitreise von damals bis
heute. In 31 kurzen, leicht verständlichen Kapiteln bietet er Fakten
und Zahlen, aber vor allem Beispiele und Geschichten. Er erzählt,
wie die Römer rund um das Mittelmeer die erste Form von globalem
Handel betrieben und wie der Italiener Luca Pacioli den Arabern die
doppelte Buchführung abschaute; was das Gasthaus der Familie van de
Beurse mit Dax, Dow Jones und Nikkei zu tun hat und wie sich die
Holländer mit Tulpenzwiebeln gründlich verspekulierten.
Und weil es oft Einzelpersonen waren, die die Geschichte prägten,
stellt Piper auch berühmte Unternehmer und Wirtschaftsdenker vor:
etwa die Fugger und die Rothschilds, Adam Smith und Karl Marx,
Ludwig Erhard und die Nobelpreisträger Keynes und Friedman. Auch
wenn die Rezepte verschieden sind- ökonomisches Denken ist so
aktuell wie je. Ob Taschengeld, Firmenkapital oder die begrenzten
Ressourcen unserer Erde – immer geht es darum, mit dem, was wir
haben, vernünftig zu wirtschaften. |
|
|
Jurybegründung
Nikolaus Piper stellt in seinem Buch die historische Entwicklung der
Wirtschaft vom Entstehen erster Formen der Landwirtschaft in der
Steinzeit bis hin zur heutigen Diskussion um die Globalisierung und
ihre Folgen in 31 kurzen Kapiteln dar. Bemerkenswert ist die
Einlösung des erzählerischen Anspruchs sowie die Verschränkung des
historisch-chronologischen Prinzips mit der Darstellung
unterschiedlicher Aspekte der Ökonomie. Anschaulich und spannend
stellt der Autor die Wirkung von technischen Erfindungen und
kulturellen Entwicklungen auf die Prozesse der Wirtschaft dar. In
kurzen Episoden entwirft Piper originelle Zeitbilder, die Geschichte
lebendig werden lassen. Durch konkrete Beispiele werden auch
abstrakte Sachverhalte verständlich. Dabei macht er das
Ineinandergreifen von Alltag, Politik, Wirtschaft und Kultur
deutlich.
Die erzählenden, teilweise ins Surreale spielenden Illustrationen
von Aljoscha Blau begleiten die Texte von Piper nicht nur, sondern
bilden eine eigene künstlerische und inhaltliche Aussageebene.
|
|
|
|
Der
Sonderpreis 2003 an den Illustrator Wolf Erlbruch |
|
|
|
Der Sonderpreis 2003 wird an den Illustrator Wolf
Erlbruch verliehen. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für ein Gesamtwerk
ist Teil des Deutschen Jugendliteraturpreises und wird im jährlichen Wechsel an
deutsche Autoren, Illustratoren und Übersetzer verliehen. Stifter ist das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. |
| |
Jurybegründung
Der Künstler Wolf Erlbruch hat in den vergangenen 15 Jahren mit seinen
Illustrationen im Bereich des Kinder- und Bilderbuches eine herausragende
Rolle eingenommen. Seine künstlerische Handschrift und seine individuelle
Bildsprache haben der Illustration der 90er Jahre eine unverwechselbare und
zugleich stilbildende Gestalt verliehen. Sowohl als gestaltender Künstler
selbst, wie auch als Lehrender in Sachen Kunst hat Wolf Erlbruch visuelle
Wegweiser gesetzt. Seine Handschrift wird als "typisch Erlbruch" erkannt und
häufig kopiert.
In seinem Bilderbuch Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf
den Kopf gemacht hat schuf er eine Bilderbuchfigur, die innerhalb
kürzester Zeit zum Klassiker avancierte und die in ihrer schnörkellosen und
respektlosen Charakterzeichnung die Sympathie großer und kleiner Leser
gewann. Seine Charaktere bieten sich für Heranwachsende ganz offensichtlich
als Identifikationsfiguren an. Das zeigt sich auch bei der Umsetzung seiner
Bilderbücher in andere Medien, z.B. in überaus erfolgreiche
Kindertheater-Stücke.
Bestechend ist bei Erlbruch die Bildtechnik der
Collage, eine Technik, die es ihm erlaubt, auf subtile Weise Abstraktions-
und Verfremdungseffekte einzubringen. Er verwendet Zeichengeräte, wie z.B.
Pinsel, Feder und Kreide, auf Papieren verschiedener Herkunft und
Beschaffenheit. Gleich, ob es sich um Landkarten oder alte Kanzleibücher,
Formelsammlungen oder japanische Buntpapiere handelt: Erlbruch spielt mit
seinem Bildmaterial, indem er es als grafisches Element und zugleich als
verfremdenden Akzent begreift. Verstärkt wird diese Wirkung durch Zitate aus
der Kunstgeschichte, die er mit leichter Hand einstreut. Auf der
eindimensionalen Ebene des Papiers entstehen Erlbruchs Räume nicht durch
perspektivisches Zeichnen allein, sondern durch spannungsvoll nebeneinander
inszenierte Linien und Flächen, durch Freiräume, Perspektivenwechsel und
gewagte Anschnitte. Seine gut komponierten szenischen Abläufe fordern ein
Denken in Text und Bild heraus, der dramaturgische Spannungsbogen wird
perfekt gespannt. Immer bleiben Offenheit und Mehrdeutigkeit gewahrt, die
dem Betrachter individuelle Deutungsansätze ermöglichen. Vor allem in den
späteren Büchern tritt auch die Schrift als grafisches Gestaltungselement im
Bild hervor (z.B. in Das Hexen-Einmal-Eins).
Erlbruch bewegt sich mit seinen Bildern zwar vielfach in der traditionellen
Figurenwelt des Bilderbuchs, zwischen Hasen, Bären und Hunden, aber er gibt
diesen eine unverwechselbar individuelle, etwas sperrige und kantige
Gestalt, die sich in kein kindertümelndes Schema einfügt. Der Auftritt
seiner skurrilen, schrägen Figuren mit ihren expressiven und prägnanten
Zügen spricht Kinder und Erwachsene an. Seine Bildästhetik lässt sich
bewusst nicht durch eine "Zielgruppe" einengen.
Wolf Erlbruchs Kinder- und Bilderbücher sind deshalb in ihrer
künstlerisch-ästhetischen und inhaltlichen Form in den 90er Jahren
wegweisend geworden. Vor allem seine Bilderbücher haben wesentlich dazu
beigetragen, dass sich der traditionelle Bilderbuchmarkt einer Öffnung
gegenüber Einflüssen moderner Kunst sowie neuen medialen Erzählformen nicht
länger verschließen konnte. |
Weitere
Literaturpreisträger
Home
|
|
|
© 1999 Buchladen Neuer Weg,
Würzburg
– Bei uns können Sie Bücher online suchen und bestellen –
Stand: 14. Januar 2007
Bei Problemen oder Fehlern schicken Sie eine eMail an:
webmaster@neuer-weg.com |
|
Der Autor
Klaus Kordon,
geboren 1943 in Berlin, war Transport- und Lagerarbeiter, studierte
Volkswirtschaft und unternahm als Exportkaufmann Reisen nach Afrika und
Asien, insbesondere nach Indien. Heute lebt er als freier Schriftsteller
in Berlin. Für sein Gesamtwerk erhielt er den "Alex-Wedding-Preis" der
Akademie der Künste zu Berlin und Brandenburg.
Die Autorin
Katja Kamm,
geboren 1969, studierte
Kommunikationsdesign und Illustration in Trier, Hamburg und New York
City. Sie arbeitet als Illustratorin und Grafik-Designerin im Hamburger
Atelier Amaldi.
Der Autor
Philip Ardagh hat über 50
Kinderbücher geschrieben. Er lebt mit seiner Frau und zwei Katzen in
einem Küstenort in England. Er arbeitete als Werbetexter,
Reinigungskraft, Bibliothekar und Vorleser für Blinde. Derzeit ist er
Vollzeit-Schriftsteller. Seine Bücher wurden in neun Sprachen übersetzt. Der
Illustrator
David Roberts, geboren in Liverpool, studierte Modedesign, bevor er
in Hongkong als Modedesigner arbeitete. Er hat bislang acht Bücher
illustriert und belegte Platz 2 des "Mother Goose Award" für
Kinderbuchillustration 1999. Heute lebt und arbeitet David Roberts in
London.
Der Übersetzer
Harry Rowohlt
ist als Autor, Übersetzer,
Sprecher und Schauspieler gleichermaßen geschätzt. Sein Pu der Bär gehört zu den
erfolgreichsten Hörbuchproduktionen der vergangenen Jahre. Schlimmes
Ende ist seine 108. Übersetzung – die natürlich niemand besser
sprechen kann als Harry Rowohlt selbst.
Die Autorin
Holly-Jane Rahlens kam nach dem Studium der Literaturwissenschaft und Theater Arts in New
York nach Berlin und arbeitete u.a. als Journalistin, Moderatorin und
Regisseurin. Die "gelernte Berlinerin aus New York" wurde durch ihre
Romane Becky Bernstein Goes Berlin und Mazel Tov in Las Vegas
bekannt. Heute lebt sie mit ihrem Mann und Sohn in Berlin.
Die Übersetzerin
Ulrike
Thiesmeyer,
geboren 1967 in Düsseldorf, studierte Englisch
und Französisch und arbeitet seit 1998 als Übersetzerin. Die
leidenschaftliche Leserin entschied sich fürs Übersetzen, weil sie darin
die Möglichkeit sieht, einen Beitrag zur kulturellen Vermittlung zu
leisten, der ihr Freude macht.
Der Autor Nikolaus Piper, geboren 1952 in
Hamburg, leitet das Wirtschaftsressort der
Süddeutschen Zeitung. Er wurde mit dem "Ludwig-Erhard-Preis für
Wirtschaftspublizistik" ausgezeichnet. Für seinen Jugendroman Felix
und das liebe Geld erhielt er den "Quandt-Medienpreis". Der
Illustrator Aljoscha Blau, geboren
1972 in Sankt Petersburg. Seit 1991 lebt er in Hamburg, wo er an der
Fachhochschule für Gestaltung studierte. Er illustrierte bereits viele
Kinder- und Jugendbücher und arbeitet für verschiedene Zeitschriften und
Magazine. 1997 erschien sein erstes Bilderbuch.
Der Illustrator
Wolf Erlbruch,
1948 in Wuppertal geboren, studierte ab 1967 Grafik-Design mit
zeichnerischem Schwerpunkt an der Folkwang-Schule für Gestaltung in
Essen-Werden. Nach dem Abschluss 1974 begann er seine freiberufliche
Tätigkeit als Illustrator in der Werbebranche. In den folgenden Jahren
publizierte er zunehmend Illustrationen in internationalen Magazinen,
u.a. in: Esquire, GQ magazine New York, Stern, Transatlantic und
twen. Er erhielt zahlreiche Preise für Illustration des Art
Director Club (ADC) in New York. Ende der 80er Jahre begann er,
Kinderbücher zu schreiben und zu illustrieren. Für Das Bärenwunder
erhielt er 1993 den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Sparte
Bilderbuch.
1990 folgte er einer Berufung zum Professor an die Fachhochschule
Düsseldorf. Seit 1997 ist er Professor an der Bergischen Universität
Gesamthochschule Wuppertal. Wolf Erlbruch lebt mit Frau und Sohn Leonard
in Wuppertal. |